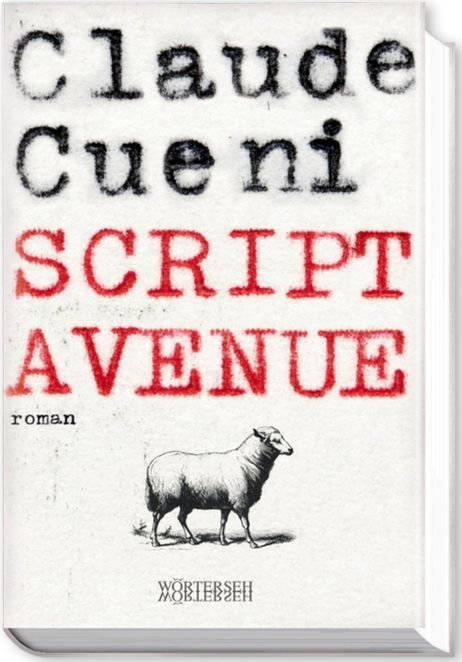Claude Cueni, Drehbuchautor und Schriftsteller

«Ich lebe wie einer, der den Koffer schon gepackt hat»
«Das Leben ist ein Kampf», diese Lektion hat Claude Cueni schon in jungen Jahren gelernt. Später verlor er seine Frau an Krebs und erkrankte an Leukämie. Während der sechs Monate auf der Isolationsstation begann er, einen autobiografischen Roman zu schreiben. Mit «Script Avenue» ist dem Basler Drehbuchautor und Schriftsteller ein Werk geglückt, das kaum einen Leser kalt lässt.
Interview: Mathias Morgenthaler Fotos: ZVG
Kontakt und weitere Informationen:
www.cueni.ch
Herr Cueni, kann man durch Schreiben dem Tod entkommen?
CLAUDE CUENI: Wenn ich schreibe, bin ich in einer anderen Welt. Das war schon immer so. Ich tauche so tief in meine Geschichten ein, dass mich nichts aus der realen Umgebung erreicht. Sie können neben mit einer Bohrmaschine den Asphalt aufbrechen oder eine Guggenmusik spielen lassen, das stört mich nicht. So wie ich stets innert einer Minute einschlafen kann, brauche ich keine 30 Sekunden, um mich aus der Welt davonzustehlen und in eine Geschichte einzutauchen.
Als Sie mit Ihrem autobiografischen Roman Script Avenue begannen, waren Sie an Leukämie erkrankt, schwebten ein halbes Jahr lang auf der Isolationsstation eines Spitals in Lebensgefahr. Ihr Sohn ermunterte Sie in dieser Zeit, Ihre Lebensgeschichte niederzuschreiben. War das Schreiben eine Art Therapie?
Die Arbeit an diesem Roman war eine grosse Anstrengung. Ich war entkräftet, geschwächt von Chemotherapie, Hirnblutung, Schädeltrepanation, Knochenmark-Transplantation und vielen Medikamenten. Das Schreiben gab mir Struktur, es zwang mich zur Disziplin, auch wenn ich nur lächerliche zwei Stunden pro Tag schaffte. Das hatte einen positiven Einfluss auf meinen Alltag, aber nicht auf meine Krankheit. Entscheidend war wohl, dass ich das Gefühl hatte, mein Sohn brauche mich. Er verlor innert kürzester Zeit seine Mutter, seine beiden Grosseltern und seinen Hund – da konnte ich nicht auch noch verschwinden. Heute bin ich entspannter. Mein Sohn ist Jurist, verheiratet, er hat ein gutes Leben und braucht mich nicht mehr unbedingt. Aber schreiben Sie nicht, ich hätte wegen meines Sohns oder durch das Schreiben die Leukämie besiegt. Kein Mensch besiegt eine schwere Krebserkrankung, das ist Glück oder Pech, keine Frage der Stärke. Sonst würde das bedeuten, dass jene, die daran sterben, sich zu wenig angestrengt haben.
Sie schreiben selber: «Vielleicht war ich so besessen von dieser Script Avenue, dass ich schlicht vergessen habe, zu sterben.»
Das ist ironisch gemeint. Aber ich mochte mir tatsächlich nicht monatelang den Kopf darüber zerbrechen, ob es mit mir zu Ende geht und ob das ungerecht wäre. Da die Leukämie nach sechs Monaten Chemos und Bestrahlungen immer noch nachweisbar war, war es unwahrscheinlich, dass ich das Jahr 2010 überlebe. Ich stürzte mich trotz allem mit Begeisterung in mein neues Buchprojekt. Ich hatte nie im Sinn, mein Leben niederzuschreiben, sondern ich wollte einen guten Roman schreiben, der dem Leser etwas bringt. Eine Schweizer «Forrest Gump»-Version, Geschichten über Familienbande, Verlust, Krankheit, aber auch 50 Jahre Zeitgeschichte aus den Sparten Musik, Film, Werbung, Politik.
Das klingt jetzt viel harmloser, als es sich liest. Sie beschreiben, wie Sie Ihre Mutter mit den Worten «Ich hasse dieses Kind» begrüsste, wie Sie die ersten Jahre auf einem jurassischen Bauernhof bei einem gewalttätigen Onkel und seiner Frau ohne menschliche Wärme lebten. War es nicht qualvoll, sich an all diese traumatischen Momente zu erinnern?
Es war körperlich sehr anstrengend, das Buch zu schreiben, aber Schreiben fällt mir immer leicht. Mir kam es eher vor, als würde ich einen Wasserhahn öffnen. Es strömten unendlich viele Geschichten heraus. Oft musste ich beim Schreiben lachen, als würde ich einen fremden Stoff bearbeiten. Die Herausforderung war, aus 100 Prozent Biografie jene 60 Prozent herauszufiltern, die sich für einen Roman eignen. Ich war stets der Dramaturgie verpflichtet – als erfahrener Drehbuchautor bringe ich es nicht übers Herz, die Leute mit belanglosem persönlichem Zeugs zu langweilen. Jeder, der einmal einen Dia-Abend mit Ferienfotos anderer Leute über sich ergehen lassen musste, weiss, wie uninteressant so etwas sein kann. Aus diesem Grund kommen zum Beispiel meine beiden Schwestern gar nicht vor – das hätte nur vom Handlungsstrang abgelenkt. Man muss wissen: Was ist der Kern der Geschichte?
Sie schreiben im Roman, Ihr Sohn habe Ihnen Musik mit den grössten Hits von jedem Jahr zusammengestellt. Waren diese Songs wirklich Ihre Erinnerungsstütze beim Schreiben?
Ja, das war eine sehr fruchtbare Sache. Ich war aufgrund der vielen Medikamente in einem Dämmerzustand und hörte die Musik aus den Sechziger- und Siebzigerjahren. Nach und nach tauchten all die Erlebnisse meiner Kindheit wieder auf, nicht nur Figuren und Geschichten, sondern auch Dialoge im Wortlaut. Ich hatte schon immer ein extrem gutes Gedächtnis für Dialoge und Szenen. Musik unterstützt die Erinnerung zusätzlich. Diese Erfahrung werden auch die Leserinnen und Leser machen. Ich wage die Behauptung: Jeder weiss, wie sein Sofa aussah, auf dem er zum ersten Mal den Titelsong zur Fernsehserie Bonanza hörte.
Sie wussten schon in jungen Jahren, dass Sie einmal Schriftsteller werden wollen. Im Kindergarten unterhielten Sie die anderen Kinder mit erfundenen Geschichten. Woher kommt dieses Talent?
Wenn man ohne TV-Apparat und Bücher aufwächst, eher isoliert, dann bleibt einem nichts anderes übrig als sich alles auszudenken. Mein Kinderzimmer fand in meinem Kopf statt. Einmal schenkte mir ein Onkel drei Elastolinfiguren, aber mit drei Römern kann man keine Schlachten inszenieren. Also dachte ich mir alles andere aus, inszenierte Geschichten, Schlachten, Dialoge. Die Script Avenue, in der das alles stattfand, wurde zu meinem Zuflucht- und Rückzugsort, und blieb es bis heute. Die Figuren, die in diesem Kopfkino auftreten, sind für mich genauso wichtig gewesen wie die Menschen aus meinem realen Umfeld.
Überkam Sie beim Schreiben nicht manchmal die Wut? Sie wuchsen in einem Milieu auf, das von Gewalt, Streit, chronischem Schlafmangel und heuchlerischer Frömmigkeit geprägt war.
Nein, so funktioniere ich nicht. Privat bin ich eher ein Komödiant. Ich habe in den letzten Jahren oft mit meinem Sohn über all diese Begebenheiten gelacht. Wer unter prekären Umständen aufwächst, gewöhnt sich früh daran, dass das Leben kein Paradies ist. Es ist ein Kampf, und oft verliert man und wird verletzt. Aber man darf nicht aufgeben. Heutzutage wundern sich die Leute, wenn etwas nicht klappt, sie geben leicht Job oder Beziehung auf, wenn es nicht läuft, wie sie sich das vorstellen. Mir wurde schon in den ersten Lebensjahren bewusst, dass wir keinen Anspruch auf absolutes Glück haben. Bei der Recherche für meine historischen Romane realisierte ich immer wieder, dass wir heute in der Schweiz im Schlaraffenland leben. Man muss nur einige Generationen zurückgehen, da starben sieben von zehn Kinder, die Menschen litten unter Kriegen, Armut, Seuchen, Hungersnöten.
Ist das wirklich ein Trost, wenn man selber so viele Schicksalsschläge erlitten hat wie Sie?
Ja, das relativiert vieles. Selbst wenn Sie in der Schweiz an Leukämie erkranken, sind Sie – im weltweiten und historischen Vergleich – ein Glückspilz. Es ist normal, dass man krank wird und stirbt.
Das klingt unheimlich abgeklärt. Sehen Sie das immer so rational, so ganz ohne Sentimentalität?
Ich bin ein Gefühlsmensch, aber mir gegenüber bin ich hart. Ich brauche all meine Kraft, um das durchzustehen und trotz Einschränkungen produktiv zu sein. Da kann ich keine Energie für Selbstmitleid vergeuden. Aber wenn es um meine Frau oder meinen Sohn geht, oder um andere Menschen generell, empfinde ich ein starkes Mitgefühl. Wenn ich sehe, wie im Film jemand stirbt, kommen mir die Tränen – sogar bei Comic-Filmen. Als Autor muss man sich in andere Menschen hineinversetzen können. Dieses Einfühlungsvermögen hat zugenommen.
Und Sie sind ernsthaft der Überzeugung, dass Sie ein Glückspilz sind?
Ich habe zwei Jahre nach dem Krebstod meiner Frau noch einmal geheiratet. Durch meine zweite Frau lernte ich die Philippinen kennen, erlebte den Alltag in der Provinz, in der sie gelebt hatte. Wenn man sieht, wie wenig die Menschen dort haben, ist es schlicht peinlich, sich hier in der Schweiz zu beklagen. Das machen nur Menschen mit einem sehr engen Horizont oder einem masslos hohen Anspruchsniveau. Ich habe viel Anlass zur Dankbarkeit. Aber natürlich ist meine Situation nicht einfach. Ich bin gewissermassen «signed off», lebe ein wenig wie ein Mars-Mensch unter normalen Menschen. Ich habe existenzielle Erfahrungen gemacht, die mich vom Alltag der meisten Leute trennen. Deshalb lebe ich wie einer, der den Koffer schon gepackt hat.
Worin äussert sich das?
Ich sammle praktisch nichts mehr, schon gar keine Magazine oder Artikel, die ich später einmal lesen könnte. Ich habe das Haus verkauft und vieles mehr. Und ich verschenke grosszügig Geld, noch mehr als früher. Diese Redimensionierung des Lebens wirkt sehr entlastend und befreiend.
Die Leukämie, an der Sie vor fünf Jahren erkrankten, ist in Ihrem Blut zwar nicht mehr nachweisbar, aber seit der Knochenmarktransplantation leiden Sie unter chronischen Abstossungsreaktionen. Es herrscht «Krieg» in Ihrem Körper, die fremden Zellen bekämpfen Ihre Organe, zeitweise benötigten Sie 500 Milligramm Kortison pro Tag. Wie geht es Ihnen zur Zeit?
Es geht mir gut, aber auf tiefem Niveau. Das Leben, das ich einst hatte, ist vorbei. Ich lag diese Woche wieder drei Tage im Spital. Die Arbeitsbedingungen werden schwieriger, aber bisher überwiegt die Leidenschaft für meinen neuen Roman. Das Lungenvolumen liegt nur noch bei 40 Prozent, es kann im besten Fall stabil bleiben. Wie lange, weiss niemand. Aber man lernt, damit zu leben. Was mich am meisten ärgert, ist der permanente Schlafmangel, weil ich ja alle paar Stunden Spasmen oder Nervenschmerzen habe. Ich habe vor fünf Jahren das letzte Mal durchgeschlafen.
«Tot ist tot, man bleibt nur in Erinnerung, wenn man Schulden hinterlassen hat», sagten Sie kürzlich in einem Interview. Haben Sie keine Angst vor dem Tod?
Ich kann mich, im Gegensatz zur grossen Mehrheit der Menschen, nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass ich vergänglich bin und sterben werde. Wir blenden ja die Zumutung des eigenen Todes aus, so gut es geht. Wenn ein Schulkollege oder ein Nachbar stirbt, lässt uns das kurz erschaudern. Wenn man aber mit dem eigenen Tod konfrontiert wird, ist das ein monumentales Ereignis. Es ist eine ganze Welt, die da untergehen wird, deine Welt, während sich die übrige Welt ungerührt weiterdreht. Das ist schwer zu akzeptieren. Deshalb denke ich lieber über meinen neuen Roman nach. Ich lebe gerne, es gibt so viele Dinge, die mich faszinieren und die ich noch lernen möchte, aber ich bin Realist und habe deshalb bereits Gespräche mit Sterbehilfeorganisationen geführt.
Ihr grösstes Talent, das Geschichtenerzählen, verdanken Sie den widrigen Umständen, unter denen Sie aufgewachsen sind. Würden Sie die These unterschreiben, dass glückliche Menschen keine packenden Bücher schreiben?
Nein, aber tendenziell schreiben wohlstandsverwöhnte Autorinnen und Autoren, die das Leben nur aus akademischer Sicht kennen, eher langweilige Bücher. Je mehr Desaster ein Autor erlebt, desto mehr Gewinn haben die Leserinnen und Leser. Etliche Autoren schreiben nicht, weil sie schreiben müssen, sondern weil es staatliche Förderung gibt. Die starren dann eine Stunde lang einen weissen Monitor an und fragen sich, ob der Staubsauger in der Nachbarwohnung stört oder ob sie ein Glas Weisswein brauchen. Die Leser wollen aber im prallen Leben fischen, nicht bei Fingerübungen zusehen.
Wie war es für Sie, die 640 Seiten Ihres autobiografischen Romans am Stück zu lesen?
Ich schrieb ja während fast fünf Jahren immer nur kleine Häppchen. Bei manchen Passagen konnte ich herzhaft lachen, bei anderen war ich sehr aufgewühlt. In regelmässigen Abständen schickte ich die Texte per Mail meinem Sohn. Als ich schliesslich die Druckfahnen erhielt und erstmals die ganze Geschichte las, fühlte ich mich dann doch erschlagen. Und jetzt, wo ich jeden Tag ein Interview gebe, werde ich täglich daran erinnert, wie gravierend meine Situation ist. Das habe ich unterschätzt. Aber ich wollte dieses Buch schreiben, ich habe mich nicht zu beklagen.
Sie sind in einem Haushalt ohne Bücher aufgewachsen und hatten doch die fixe Idee, Schriftsteller zu werden.
Ich war besessen von all meinen Geschichten und wollte mein Leben partout in diesem Universum verbringen. Natürlich war ich furchtbar naiv, ich brannte für etwas und hatte gleichzeitig keine Ahnung von diesem Beruf. Für mich galt schon ganz früh: «Das Spiel gewinnen oder untergehen.» Ich hatte stets eine sehr spielerische, aber auch kämpferische Einstellung zum Leben. Deswegen hatte ich auch nie einen Plan B. Über die Jahre erhielt ich unzählige Absagen, allein das erste Buch wurde über 100-mal abgelehnt, bevor es gedruckt und ganze 540-mal verkauft wurde. Aber keine Absage erschütterte mich, jede bestärkte mich in meiner Entschlossenheit. Ich begriff und akzeptierte stets, dass ich mein Handwerk verbessern musste. Ich machte einfach weiter, wie die Bauarbeiter, die in den Alpen bohren und bohren und wissen: eines Tages kommt der Durchbruch. So begann ich jeden Tag vor Sonnenaufgang mit Schreiben, schrieb mir die Finger wund und den Nacken steif. Schreiben war ja vor Erfindung der elektronischen Schreibmaschine auch körperlich ein Krampf.
Zehn Jahre lang waren Sie chronisch erfolglos. Wovon haben Sie gelebt in dieser Zeit?
Ich habe sehr viele Jobs gemacht, um mir den Luxus des Schreibens leisten zu können – aber immer nur solche, die ergiebig waren für meine Bücher. Ich kellnerte in Bierhallen und Bars, arbeitete im Paketversand auf dem Bahnhof, als Assistent am Strafgericht, als Nachhilfelehrer, in einem Jagd- und Waffengeschäft und als Assistent eines iranischen Händlers. Das war alles sehr ergiebig, als Gerichtsassistent hatte ich mit Menschen zu tun, deren Biografien wie für Romane geschaffen waren. Und als ich für eine Versicherungsgesellschaft arbeitete, vertiefte ich mich in unzählige Dossiers aus literarischem Interesse. Frustrierender war die Arbeit als Datatypist und das Verfassen von Bedienungsanleitungen: Viertliga-Fussball und Video-Recorder gaben wenig Stoff her.
Wie schafften Sie den Durchbruch?
Als Werbetexter wurde ich erstmals für kreatives Schreiben belohnt. Dann wurde endlich ein erster Roman verlegt. Da die Auslandstherapien für meinen Sohn sehr teuer waren, begann ich, Drehbücher zu shreiben, und schliesslich erhielt ich zahlreiche Aufträge für TV-Krimis wie Eurocops, Peter Strohm oder Tatort. Es waren goldene Zeiten für Drehbuch-Autoren. Erstens mischten sich Regisseure und Dramaturgen damals noch nicht in unser Metier ein, zweitens musste nicht alles politisch korrekt sein und drittens erhielten wir bei jeder Wiederholung das volle Honorar.
Sehr erfolgreich waren Sie danach mit Computerspielen.
Das war die Folge eines Unglücks. Ich recherchierte 1,5 Jahre für einen grossen Roman über Hannibal und musste dann miterleben, wie mir Gisbert Haefs mit seinem grossartigen Roman zuvorkam. Ich suchte nach einem Weg, die Erkenntnisse aus meinen Recherchen in anderer Form zu nutzen – und kam auf die Idee, mit einem Programmierer und einem Grafiker Computerspiele zu produzieren. Damals gab es erst ein paar simple Games. So schufen wir erst das Computerspiel Hannibal und entwickelten danach MiniGame, europaweit das erste interaktive TV-Telefonie-Spiel. Es bescherte dem Schweizer Fernsehen zehn Jahre lang beste Einschaltquoten.
Später verkaufen Sie die Computerspiel-Firma und investierten Zeit und Geld in aufwendige historische Romane. Diese fanden zwar viele Leser, aber relativ wenig Echo in den Feuilletons der Zeitungen. Wurmt Sie das?
Es ist tatsächlich so, dass historische Romane in Spanien, Italien, Frankreich und Holland wesentlich mehr geschätzt werden. Ich habe wahrscheinlich im spanischsprachigen Raum mehr Leser als im deutschsprachigen Raum. Meine Freunde sind nicht die Feuilletonisten, sondern die Leserinnen und Leser, die mir ihre Leseeindrücke mitteilen. Ich beantworte seit 20 Jahren jede Mail innerhalb von 24 Stunden. Sofern ich zu Hause bin.
Welche Rückmeldung hat Sie besonders beeidruckt?
Vor einigen Monaten erhielt ich ein berührendes Mail von einem Leser aus Mexiko, der meinen Roman «Cäsars Druide» irgendwie runtergeladen und gelesen hatte. Der Mann ist Spastiker. Er schrieb mir, die Lektüre habe ihm die Energie und den Mut gegeben, trotz seines Handicaps wieder in der Arbeitswelt Fuss zu fassen. Wenn meine Bücher das Leben einiger Menschen verbessern, dann brauche ich keinen Applaus vom deutschsprachigen Feuilleton. Die Gunst der Kritiker hängt auch stark davon ab, wie sehr man als Künstler am Kulturbetrieb teilnimmt. Da ich jahrelang vier bis fünf Stunden pro Tag ins Training mit meinem Sohn investierte, der nach der Geburt eine spastische Lähmung erlitt, hatte das bei mir nie Priorität. Menschen sind wichtiger als Bücher.
Welches sind Ihre Ziele für die Zeit, die Ihnen bleibt?
Ich mache sehr viel Fitness, um die Lungenabstossung zu kompensieren. Dann will ich bald zwei Romane, die praktisch fertig sind, noch überarbeiten. Ich lasse Texte gerne ein paar Monate liegen, damit ich sie später mit der nötigen Distanz durchgehen kann. Und natürlich freue ich mich auf die Fussball-WM, aber auch auf das grössere iPhone6 und diverse neue DVDs. Das Wichtigste bleibt die Zeit mit meiner Frau und meinem Sohn.
Sie kennen sich aus mit Bedienungsanleitungen. Manche Menschen klagen, es sei ein Jammer, dass man erst gegen Ende des Lebens erkenne, worauf es eigentlich angekommen wäre. Gibt es eine Erkenntnis, die Sie gerne weitergeben würden – als Bedienungsanleitung für ein gutes Leben?
Es gibt keine universelle Bedienungsanleitung. Aber ich denke, dass es sich lohnt, mehr in Beziehungen zu investieren. Was ich für meinen Sohn getan habe, schenkt er mir heute tausendfach zurück.
24. und 31. Mai 2014