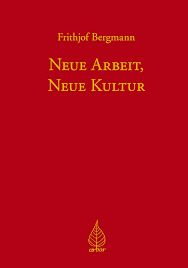Frithjof Bergmann, Philosophie-Professor und Begründer der «New Work»-Bewegung

«Die meisten Menschen sind drei Viertel tot»
Warum mühen sich so viele Menschen das halbe Leben lang in einem langweiligen Job ab und kaufen mit dem verdienten Geld dann Dinge, die sie nicht brauchen? Der Philosoph Frithjof Bergmann, Begründer der «New Work»-Bewegung, arbeitet seit Jahrzehnten an Alternativen zum kapitalistischen Lohnarbeitssystem. Arbeit, sagt der 86-Jährige, müsse keine lästige Pflicht sein, sie könne uns auch lebendig machen. Dafür müssten wir allerdings herausfinden, was wir «wirklich, wirklich wollen».
Interview: Mathias Morgenthaler Foto: zvg
Kontakt und weitere Informationen:
www.newwork.global
Herr Bergmann, wir treffen uns hier in Berlin am Rande einer Tagung zum Thema «New Work», an der Sie als Redner aufgetreten sind. Staunen Sie manchmal, was heute alles unter dem von Ihnen in den Achtzigerjahren geprägten Begriff «Neue Arbeit» veranstaltet und verkauft wird?
FRITHJOF BERGMANN: Ich habe da in der Tat zwiespältige Gefühle. Einerseits geniesse ich es, mit 86 Jahren noch eingeladen und gehört zu werden, ja mehr als das: Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren so berührt von meinem Referat, dass wir lange nach Veranstaltungsende noch im kleineren Kreis weiterdiskutiert haben. Eigentlich sind die Leute ja nicht berührt von mir, sondern von sich selber, von dem Teil in ihnen, der über all die Jahre verkümmert ist. Wir haben uns jedenfalls bis weit in die Nacht hinein ausgetauscht – deshalb empfange ich Sie in etwas unausgeschlafenem Zustand hier auf meinem Hotelzimmer. Aber mit ein wenig Geduld und viel Kaffee sollte es gehen.
Sie sprachen von zwiespältigen Gefühlen. Was hat Sie befremdet an der vom Netzwerk Xing organisierten «New Work»-Tagung?
Ich habe mir diese «Neue Arbeit» schon anders vorgestellt, als sie heute zelebriert wird. Mir geht es um grundlegende Dinge, darum, dass Menschen sich nicht in Lohnarbeit, zu der sie keinen inneren Bezug haben, erschöpfen und am Lebensende feststellen, dass sie gar nicht richtig gelebt haben. Hier wurde sehr viel über Führungstechniken und Organisationsfragen geredet, also darüber, wie Unternehmen ihre Angestellten noch raffinierter domestizieren und ausbeuten können. Bezeichnenderweise waren vor allem gut bezahlte Führungskräfte auf der Bühne, die zu Führungskräften im Plenum darüber sprachen, wie flexibel und kreativ die Arbeit in Zukunft organisiert sein wird. Diese Perspektive hat mich nie interessiert. Ich bin zwar Philosophie-Professor, aber ich habe es immer darauf angelegt, mich nützlich zu machen, etwas Grundlegendes zu bewirken. Und ich arbeitete immer mit den Machtlosen und Bedürftigen.
Sie gründeten 1984 in Flint bei Detroit ein erstes «Zentrum für Neue Arbeit». Wie kam es dazu?
Flint war das Zentrum der Automobil-Industrie. Ende der 1970er-Jahre waren dort aufgrund der ersten grossen Automatisierungswelle sehr viele Arbeitsplätze bedroht. Wir sagten voraus, dass wegen der absehbaren Massenentlassungen bald die Hälfte der Mitarbeiter ihre Lebensgrundlage verlieren würde und dass danach ein tiefer Graben durch diese Stadt gehen würde. Wir schlugen General Motors deshalb vor, nicht die Hälfte der Leute auf die Strasse zu stellen, sondern die Mitarbeiter nur noch die Hälfte des Jahres bezahlt arbeiten zu lassen und ihnen die andere Hälfte des Jahres Zeit zu geben, sich mit etwas Interessanterem, Aufregenderem zu beschäftigen – mit dem Ziel, dass die Angestellten in dieser Zeit mit unserer Hilfe herausfinden konnten, was sie wirklich, wirklich wollten.
Diese Formulierung, für die Sie später berühmt geworden sind, muss ziemlich naiv geklungen haben in den Ohren der Automanager.
Tatsächlich erntete ich am Anfang lautes Gelächter. Woher sollten diese Arbeiter nach 20 Jahren am Fliessband wissen, was sie wirklich machen wollten? So naiv konnte nur ein Philosophieprofessor sein, fanden viele. Wir waren aber durch Pilotprojekte in Detroit sehr gut vertraut mit der Industrie und konnten so das Management von GM überzeugen, dass es besser war, in ein «Zentrum für Neue Arbeit» zu investieren als blutige Kämpfe gegen die Gewerkschaften auszufechten und das Image zu ruinieren. Wir spürten bald, wie viel Energie da freigesetzt wurde durch die neuen Perspektiven, die wir den Angestellten geben konnten. Ein Fabrikarbeiter, der nicht am, sondern unter dem Fliessband gearbeitet hatte, eröffnete mit grossem Erfolg ein Yoga-Studio und erwies sich als der perfekte Lehrer. Ein anderer, der sich selber als Fabrikratte bezeichnet hatte, widmete sich ernsthaft seiner Leidenschaft für das Schreiben, zunächst bei einer Lokalzeitung, später schrieb er für das «Wall Street Journal» und schliesslich wurde er Bestseller-Autor.
Und was folgern Sie daraus?
Nicht nur diese Fabrikarbeiter mussten erst herausfinden, was sie wirklich, wirklich tun wollten, sondern die meisten Menschen wissen es nicht, weil ihnen das dafür notwendige Organ abtrainiert worden ist. Und weil wir es noch immer als ungehörig empfinden, überhaupt danach zu fragen. Wir sind so tief verstrickt in diesem Lohnarbeitssystem, in diesem Lastesel-Dasein, dass wir denken, es sei normal, die meiste Zeit unseres Lebens einer langweiligen Tätigkeit nachzugehen, die uns abstumpft, entmutigt, zu Arbeitskräften und Konsumenten degradiert. Es gibt sehr viele Arten, das Leben nicht zu leben. Die meisten Menschen sind drei Viertel tot, lange bevor sie beerdigt werden. Sie werden schon in der Schule mit Langeweile gequält, lernen alles, nur nichts über sich, und werden auf den Ernst des Lebens vorbereitet, also darauf, ein Rädchen in einem grossen Getriebe zu werden. Später gehen sie zur Arbeit und erleben diese wie eine milde chronische Krankheit, die sie zwar nicht umbringt, aber auslaugt. Und eines Tages müssen sie sich eingestehen, dass sie sich selber verloren oder vielleicht nie gefunden haben. Wir kommen alle ohne ein Ich auf die Welt und sind auf günstige Bedingungen angewiesen, um eines entwickeln zu können.
Wie haben Sie herausgefunden, was Sie tun wollen?
Ich bin in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Mutter war Jüdin, sie sollte im Zweiten Weltkrieg in ein Konzentrationslager gebracht werden, konnte aber dank glücklichen Zufällen fliehen. Sie hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen, alle glaubten, sie habe sich ertränkt, auch ich wuchs in dieser Gewissheit auf. Mein Vater, ein evangelisch-lutherischer Pfarrer, war in den letzten Kriegsjahren im Gefängnis und wurde dort sehr krank. Ich musste deshalb schon als 10-jähriges Kind für mich sorgen, hart arbeiten auf Bauernhöfen und eine schwere Krankheit überwinden. Das hat meinen Kampfgeist geweckt. Und dann durfte ich als 18-jähriger Gymnasiast einen Aufsatz darüber schreiben, welche Schule ich mir wünschen würde. Ich entwarf die Utopie einer Schule, welche die Heranwachsenden stärkt und in ihrer Entwicklung fördert, statt sie mit Wissen abzufüllen und ihnen Disziplin einzuprügeln. Dadurch änderte sich zwar nichts an der Schule, aber alles in meinem Leben. Ich gewann den Hauptpreis, ein einjähriges Stipendium in den USA. Nach der Matura trat ich die Reise an, und statt für ein Jahr blieb ich für den Rest meines Lebens.
Wie haben Sie in der Fremde herausgefunden, welches Ihre Berufung ist?
Indem ich sehr verschiedene Berufe ausübte und auf jene Menschen hörte, die einen klareren Blick für meine Begabungen hatten als ich selber. Man tappt ja selber meist im Dunkeln, wenn man seine Talente sucht, weil man das Naheliegende übersieht oder nicht mutig genug ist. Ich arbeitete als Fabrikarbeiter am Fliessband, als Bauarbeiter, Tellerwäscher, Preisboxer und als Hafenarbeiter. Die Arbeit mit Schiffen am Dock reizte mich, weil mich der Film «On the Waterfront» mit Marlon Brando tief beeindruckt hatte. Ich lud einen Sommer lang Unmengen von Getreide von Eisenbahnwagen auf alte Schiffe um. Als ich mich eines Tages erkundigte, wohin das Getreide gebracht werde, erfuhr ich: Es wurde von Portland in den nächsten Hafen nach Astoria geschafft, wo man es verfaulen liess, damit der Getreidepreis nicht sank.
Was hat dieses Erlebnis bei Ihnen ausgelöst?
Sie müssen sich vorstellen: Ich hatte kurz zuvor noch Hunger gelitten und wusste, dass in Deutschland nach dem Krieg das Essen knapp war. Es hat mich deshalb sehr beeindruckt und ins Grübeln gebracht, dass hier ein Grundnahrungsmittel vernichtet wurde, während andere nicht genug zu essen hatten. Und ich gewann in jungen Jahren den Eindruck, die Ökonomie mit ihren teils unsinnigen Anreizen sei ein Teufelsding, ein übles Gedankengebäude, das hinterfragt und neu gedacht werden muss. Zudem wunderte ich mich über die Rolle der Gewerkschaften. Dank des Boxens war ich in guter körperlicher Verfassung und arbeitete als Hafenarbeiter hart. Die Kollegen bremsten mich immer wieder mit der Begründung, sie hätten sich mit gewerkschaftlicher Hilfe das Recht erkämpft, langsam zu arbeiten. Die Situation war also doppelt verrückt: Wir taten die falschen Dinge und empfanden es als Fortschritt, diese Arbeit langsam zu verrichten. Mir scheint, das lässt sich auch heute noch beobachten.
Damals hat es Sie zum Philosophen werden lassen?
Nein, so direkt ging das nicht. Ich lebte während zweier Jahre als Selbstversorger in den Wäldern von New Hampshire, wollte aber eigentlich Schauspieler werden und schrieb Drehbücher für Filme und vor allem Theaterstücke. Einige Stücke wurden aufgeführt, durchaus erfolgreich, aber meine engsten Freunde gaben mir zu verstehen, dass meine Reden besser waren als meine Stücke und mein Schauspiel; zudem trete in jedem meiner Stücke ein Welterklärer auf, weswegen es vermutlich besser wäre, ich würde die Philosophie zu meinem Beruf machen. Ich sträubte mich zunächst, denn die Professoren, die ich kannte, kamen mir allesamt wie Mumien vor. Doch dann fügte ich mich und merkte schon im Studium, wie richtig diese Wahl war, wie sehr ich lebendig wurde beim Philosophieren.
War das nicht ein beschwerlicher Weg: vom Hafenarbeiter zum Philosophie-Professor?
Es wäre viel schwieriger gewesen, wenn ich das Studium als behüteter Akademikerspross in Angriff genommen hätte. Ich halte es für eine schreckliche Dummheit, dass junge Menschen, die den akademischen Weg einschlagen, bis zu einem Drittel ihrer Lebenszeit von der Arbeit abgehalten und auf die blutleere, praxisferne Auseinandersetzung mit der Theorie reduziert werden. Nur indem sie arbeiten, erfahren sie etwas über sich und die Welt. Ich selber erlebte im Studium die Vorteile der Ignoranz: Zu meinen akademischen Lehrern in Princeton gehörten Kurt Gödel und Clarence Irving Lewis, zwei der berühmtesten Philosophen dieser Zeit. Da ihre Namen mir kein Begriff waren, diskutierte ich unbefangen und furchtlos mit ihnen, kritisierte sie für Schwächen in ihrer Argumentation – und wurde für mein unerschrockenes Denken belohnt und gefördert.
Sie haben sich als Philosophie-Professor nicht auf Forschung und Lehre beschränkt, sondern sich immer wieder eingemischt – speziell in Regionen, die von Massenarbeitslosigkeit oder extremer Armut bedroht waren. Sind Sie zufrieden mit dem Erreichten?
Die Neue Arbeit, wie sie mir vorschwebt, ist an einigen Orten sichtbar geworden, etwa in Detroit und Flint, wo es auch dank unserem Engagement gelungen ist, eine Spaltung der Gesellschaft in Erwerbstätige und Arbeitslose zu verhindern. Aber es hat sich leider zu wenig Grundlegendes geändert. Es ist mir ein Rätsel: Die grosse Mehrheit der Menschheit lässt sich verführen, eine Arbeit zu verrichten, die sie müde macht und klein hält, um dann Dinge zu kaufen, die sie nicht braucht. Wir hätten dank des technologischen Fortschritts die Möglichkeit, mit wenig Aufwand die Dinge herzustellen, die wir zum Leben brauchen, und die Armut weltweit abzuschaffen. Stattdessen strampeln wir uns, angetrieben von Konsum- und Wachstumswahn, in sinnentleerten Jobs müde, verbrauchen Ressourcen im Übermass und verschärfen die Kluft zwischen Reich und Arm. Ich weiss nicht, warum wir nicht aus dieser Lethargie aufwachen wollen. Vermutlich ist es eine Mischung aus Armut an Begierde und Mangel an Phantasie, uns Alternativen auszudenken zum klassischen Lohnarbeitssystem.
Wie sieht denn Ihre Alternative aus?
Die «Neue Arbeit» hat drei Pfeiler: Erstens sollen Menschen herausfinden, was sie «wirklich, wirklich tun wollen» und darin unterstützt werden, mit ihrer Berufung Geld zu verdienen. Das bedingt auch, dass sich unser Schulsystem viel konsequenter auf Potenzialentfaltung konzentriert statt die jungen Menschen fit zu machen für einen Arbeitsmarkt, den es nach deren Schulabschluss so gar nicht mehr geben wird. Zweitens sollen die Dinge des täglichen Gebrauchs in regional organisierten Gemeinschaften hergestellt werden, wie das etwa beim Urban Gardening oder in Reparaturwerkstätten schon passiert. Und drittens sollen genossenschaftlich organisierte Unternehmen aufgebaut werden, in denen die Menschen nicht nur Angestellte, sondern auch Unternehmer sind. Wir müssen aufhören, Jobs zu erhalten, die keinem überzeugenden Zweck dienen und die Menschen krank machen. Es gibt in unserem Lohnarbeitssystem sehr viel Scheinarbeit, die nur dazu dient, die Illusion von Vollbeschäftigung aufrecht zu erhalten. Da arbeiten Menschen in grossen Organisationen in einem lachhaft engen Jobprofil und lassen ihre Talente verkümmern aus Angst davor, ohne Arbeit dazustehen.
Mir ist nicht klar, wie Ihr Gegenentwurf aussieht.
Wir sollten uns von der Wahnvorstellung lösen, die Menge der Arbeit sei begrenzt. Begrenzt sind die Jobs, wie wir sie kennen, und offen gesagt ist es kein Unglück, wenn viele dieser Jobs verschwinden respektive von Maschinen verrichtet werden. Es gibt Alternativen zu diesem Lohnarbeitssystem, dem wir uns die letzten 200 Jahre unterworfen haben und das von uns verlangt, dass wir als Gegenleistung für die Existenzsicherung einen monotonen Job verrichten. Statt Grossunternehmen, in denen die Bürokratie und die Angst regieren, brauchen wir vermehrt kleine kooperative Organisationen, in denen Menschen wirklich etwas voranbringen wollen. Ermutigende Ansätze gibt es viele: Ich denke an die freie Softwareentwicklung, welche die ganze IT-Branche revolutioniert, aber auch an Unternehmen wie Google, die ihre Angestellten auffordern, einen Tag pro Woche eigene Projekte zu verfolgen, und an starke Stiftungen, die wichtige Arbeit ermöglichen. Die Zeit, in der die Wirtschaft diktierte, welche Jobs es gibt und welche Produkte wir kaufen, neigt sich dem Ende zu. Je mehr Arbeit uns von Maschinen abgenommen wird, desto wichtiger werden Fähigkeiten wie Kreativität, Kooperation und Empathie.
Was wird aus Ihrer Vision der «Neuen Arbeit», wenn Sie sich einmal nicht mehr persönlich dafür einsetzen können?
Ich bin dankbar, dass ich in meinem 87. Lebensjahr noch immer mit voller Leidenschaft das tun kann, was ich wirklich, wirklich will. Aber ich könnte schon morgen mit einem guten Gefühl gehen. Was nach meinem Tod passiert, beschäftigt mich nicht. Obwohl ich keine Vorkehrungen getroffen habe, halte ich die Gefahr für klein, dass dann alles in sich zusammenfällt. Die offenen Technologie-Labore, kurz: Otelos, verbreiten sich von Österreich aus rasend schnell, fast wie eine Epidemie. Und wenn ich sehe, wer sich alles mit mir verbinden möchte, um die «Neue Arbeit» voranzubringen, fühle ich mich wunderbar aufgehoben in einer grossen Familie.
10. und 17. Juni 2017